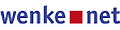
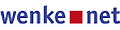
Musik. Krach. Wien.
Der Lärm und die Musik
Ich weiß nicht, wie Sie es empfinden. Aber mir geht die Permanenz und extrem nahe bei Trash, Müllkübel, angesiedelte Qualität akustischer Belästigung mächtig auf den Keks. Beinahe jede zweite oder dritte gastronomische Einrichtung verlassen meine Frau und ich ohnjedwede Einnahme von Speis und Trank, ja sogar ohne Auswahl eines in Frage kommenden Sitzplatzes pirouttenhaft auf dem Absatz kehrt machend, weil uns dieser Würgereize erzeugende Einheitsbrei computergenerierter inhaltsleerer Musik – oder an und für sich gar nicht so schlechte Musik in einer Lautstärke – entgegenhallt, die dem mit wohligen Schmausen verbundenen Wunsch nach Ruhepause diametral entgegen steht und seine Erfüllung unmöglich macht.
Ob im Tempel der Konsumgläubigkeit, vulgo Kaufhaus, oder
neuerdings während rumpelnden
Wolkenüberflüge im Discount-Airliner, in der
Artzpraxis vor allem (Medizinklempner, nachdem man drei Stunden wegen
der überforderten, unterbezahlten Rezeptionshühner im
Schalldauerbeschuss des unbelüfteten Wartezimmers jegliche
Tagesplanung obsolet werdend erleben musste: „Oh, Sie haben
aber hohen Blutdruck! – Quacksalber!), ob vor,
während, nach einem so genannten Sportereignis –
ewig diese Beliebigkeit arrogant und fälschlicherweise Musik
genannter Töne. Ja, Beliebigkeit.
Das Haus der Musik in Wien, das trotz, wegen oder wohleingebettet
rhythmisch hinter würdig-barocker Fassade mitten im 1., also
ersten Bezirk, didaktisch-museal aufbereite
Klangexperimenträume ebenso bereit hält wie nicht
minder kitschiges Andenken an all das, was dem durch „alles
auf einen Blick“-Reiseführer ge- respektive
ungebildeten Touristen ohnehin als Synonym für die Kombination
„Wien und Musik“ aufgedrängt wird. Also
Walzer und die Straußens, Liszt und Mozart, k. und k.
Märsche samt deren Komponisten, Interpreten und
Globalverbreiter, wozu natürlich das Neujahrskonzert des
Wiener Konzertvereins und und die eigens dafür aufgebotene
Tafel der Triumphe der Stardirigenten zählt.
Ach ja, Museen sind ja, wollen sie als modern gelten,
besucher-interaktiv: denn zu dieser Riege der Stardirigenten darf man
sich gesellen, wenn man den Laserpointer-Dirigierstab in die Hand nimmt
und das videografisch im Takt der eigenen Armschwünge
dahinruckelnde Orchester versucht, in gleichmäßiges
Musizieren zu bringen, was trotz intensiver Übung im Stile
seniorengerechter aquagymnastikgerechter Armwinkereien zur Abwehr
osteoporotischer Maläste eher kaum gelingt. Worauf, als
running gag sozusagen, im Video ein Musiker aufsteht und seine Kollegen
auffordert, dem Dirigenten doch endlich zu sagen, wie schlecht er sei.
Ach, sagte nämlicher als ernsthaft anzusehende Musikus das
doch mal über das Gedudel heutiger, vor allem auch
öffentlich subventionierter Radiosender. Um die Dramatik
der Zumutung gegenüber den Ohren der gestressten,
genervten, oder wie Komponisten-Kollege und Wien-Fan von Beethoven,
Ludwig, ebenfalls immer mehr zur Taubheit tendierenden heutigen
Allgemeinbevölkerung subtil, aber wirkungsvoll aufzuzeigen. Um
klarzumachen, wie sehr Harmonie und Hirnlosigkeit verwoben sind, hat
sich das Museum Verdienste erworben.
Eines davon ist ein Zufallsgenerator, wie ihn, nur elektronisch und ein
wenig vielfältiger, auch mein Standardnormalapplemac aufgrund
eines sonderangebotsartig preiswerten Programmes ohnehin an Bord hat.
Zugegeben, das Haus der Musik wahrt da mehr musikalische Würde
und zeigt die würfelartige Beliebigkeit der Musik im
Stilklange des Mozartismus eben anhand des genannten Gegenstandes: der
Besucher kann sich einen Walzer zusammenwürfeln. Die Augenzahl
bestimmt eine Notenfolge, ergo lassen sich bei zwei Instrumenten und
vier Takten immerhin einige hundert scheinbarer Zufallsmelodien
„komponieren“. Die dann brav vorgespielt werden und
die man als kostenpflichtigen Notendruck auf einer Urkunde mit in den
Rast des eigenen Lebens nehmen darf. Als Kollege des Wölfels
sozusagen, wie jenes zu Lebzeiten zur Verarmung neigende angebliche
Genie gerne insiderisch-wohlwollend, vereinnahmend genannt wird. Im
Armengrab verscharrt, hat seine zwischen Ausnahmegenie und billiger
Dutzendware kaum einzuordnende Komponiertätigkeit eine ganze
Musikindustrie hervorgebracht, die heuer, 250 Jahre nach seinem
Eintritt in die Menschheitsgeschichte, in Wien ebenso zur
allergie-erzeugenden Überdrußaufdringlichkeit
geworden ist wie die für unsere Tage so charakteristische
Techno-, Rap-, Beat-, Disco-Musik.
Deren Herkunft ohnehin der Computer ist, das heutige
Gegenstück zu den damaligen Vielschreibern wie Bach oder eben
Mozart. Was heute die Charts sind, waren früher die
Höfe oder auch die Kirchen, die ständig und
unaufhörlich nach Neuem verlangten. Was dann sehr schnell
einen Stil zur Masche verkommen lässt. Kunst wird zur Dudelei.
Damals. Heute dagegen versucht man frech Dudelei als Kunst darzustellen.
Aber im Haus der Musik, Kultur geht vor Effekt, handelt man die
akustischen Müllhalden der Jetztzeit wenigstens noch
erlebnispädagogisch ab. Da darf man die eigene Stimme in
Mikrofone hauchen, brüllen, stottern oder stöhnen,
auf dass ein nicht näher benannter Verzerrcomputer aus
nämlichem Stimmlaut eine mechanisch bis synthesizerhaft
verzerrte Lautfolge macht, deren unwiderholbar momentane Darbietung
Klangexperiment genannt wird. Das ist zwar in Zeiten
allgegenwärtiger Computer und mehr noch, einer sich durchaus
beachtenswerter Beliebtheit erfreuender Karaoke-Welle weder etwas Neues
noch Besonderes, macht aber wegen der konsequenten mystischen
Dunkelheit der zu durchwandernden Museumsräume und ihre
Assoziation an die Unendlichkeit des Weltraums wenigstens noch
Spaß und ist den Eintrittspreis wert.
Zumal man aus dem Weltraum auch Klänge hören und
erleben darf (was man auch per Internet auf der Nasa-Website genau so
könnte), etwa das in Akustik umgesetzte Singen, Heulen,
Rauschen und Sirren von Jupiter, Sonnenstürmen oder
radioaktiver Hintergrundelektronik des realen Weltalls, also unseres
Seins. In das wir gleich zu Beginn der Experimentalstrecke auf eine
allerdings in dieser Art wohl eher erst- und bislang einmalige Art
gesteckt werden, nämlich akustisch-direkt in die
Gebärmussterhöhle, wo wir dann angeblich (obwohl wir
ja alle dort waren, wissen wir es nicht mehr) jene Töne in der
Form hören, die den Fötus während seiner
Kuschelzeit tief im Körperinneren begleiten: Pochen, Rauschen,
dumpfe Schläge –
biologisch-dokumentarfilm-interessierte Menschen werden an die
Unterwassertöne von Delfinen und Walen erinnert. Vielleicht
sind wir ja, rein akustisch, verwandter mit manchem vor allem
Seegetier, als wir es uns vorstlelen können. Ohr sei dank kann
man wenigstens darüber phantasieren.
Das Haus der Musik in Wien verabschiedet uns als klanginteressierte,
alltagsmusikgeschädigte Besucher wenigstens mit einer Episode
aus dem richtigen, echten Leben. An irgendeiner der
berührungsheischenden Bildschirme, die stets mit nach
korrekter DJ-Optik ausgestatten Kopfhörern begleitet sind,
wird man aufgefordert, mittels viruteller Schiebereglern und Auswahl
einer Streuwiese akustisch vorgefertigter respektive konservierter
Schallquellen und Ereignisse eine eigene Beliebigkeittskomposition zu
erstellen. Eben nicht im Walzerrhythmus wie in der Abteilung Altwien,
sondern eher analog dem Krach, den man auch draußen auf der
Straße haben könnte. Für milde 7 Euro und
20 Cent ist dann die Dreiminuten-Einmaligkeit auf CD gebannt und
gebrannt im Museumsshop abholbar. Ja –, denkste. Dort
angekommen, Namen genannt und das eigene musikalische Erbe an die
Menschheit zum Kaufe erheischt, verkündet das durchaus
kompetent agierende Wienfräulein mit dem sympathischen Tremolo
des Entsetzens in der Stimme, der von einer musikalischen Vor-, Neben-
oder Naturausbildung zeugt, dass der File, soeben gesichtet, korrekt
als „kopiere und brenne“ angeklickt,
plötzlich und zum ersten Male überhaupt ins
Nichtwiederauffindbarkeitssein der geöffneten Fenster
verschwunden sei. Ich schaue, einerseits beruflich kenner- und
anderseits wegen des Zustandes der so genannten Freizeit
gönnerhaft auf den Bildschirm der fassungslosen Elevin und
stelle disharmonisch fest: Aha, Windows! Passt eben zu Chaos.
Fröhlich verlasse ich, klingend-schwingend,
melodisch-methodisiert, das Museum und beschließe, die
richtige Wahl getroffen zu haben, wenn ich Bericht, Wieder- und
Weitergabe der klangfüllenden Erlebnisse im musischen Wien
samt alle meine Kompositionen fürderhin, wie bisher auch, dem
Mac anvertraue. Vielleicht schafft ja dann jene Komposition, die ich
allein durch die Bewegung meines eigenenen Körpers,
aufgefangen und elektrisch impulsiert durch einen
Röhrenozillographen und hernach durch den Ab- und Aufruf
akustischer Versatzstücke als spontane Wenke-Symphonie Nummer
eins ins Leben gerufen habe, den Weg in den Olymp der Welt des
schönen Klangs.
Der dank Mozart und der heutigen Dauerbeschallung das geworden ist, was
Musik niemals verdient hat: eine Belästigung, für
deren schweigende Nichtdarbietung man inzwischen eine tiefe Dankbarkeit
empfindet.
Gegenben zu Wien, den 18. November a. D. 2007